15.08.23
Umweltgifte und Gesundheit: Glyphosat, Chlorpyrifos, Bisphenol A
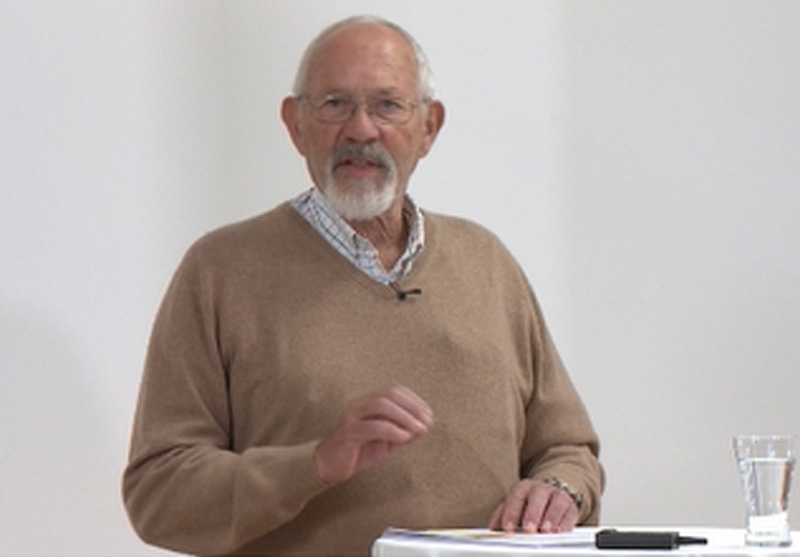
Schützen uns Verordnungen?
Nicht nur Nährstoffmängel, auch Umweltgifte können krank machen. Der Kieler Umwelttoxikologe Dr. rer. nat. Hermann Kruse beschäftigt sich seit Jahren mit möglichen Folgen für unsere Gesundheit. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Risiken von Schadstoffen ausgehen, wie Grenzwerte festgelegt werden, wie gut sie unsere Gesundheit schützen und was wir selbst zu unserem Schutz beitragen können. (1)
In vielen Obst- und Gemüsesorten lassen sich Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachweisen. Sie bleiben zwar meist unterhalb der zulässigen Werte, doch es gibt Ausnahmen. So zeigen (nicht repräsentative) Untersuchungen aus Schleswig-Holstein, dass einige pflanzliche Lebensmittel sogar die Grenzwerte für Pestizide überschreiten und damit nicht mehr auf den Markt dürften. Mit 5 bis 7 % am höchsten war dieser Anteil bei Obst- und Gemüsezubereitungen für Säuglinge und Kleinkinder. Besonders häufig Pestizid-belastet sind Wein, Ananas, Erdbeeren, Pfirsiche und Nektarinen, Himbeeren, Äpfel, Kopfsalat, Tomaten, Rosenkohl, Pflaumen, Spinat und Avocado. In mehr als der Hälfte der Proben wurden Pestizide gefunden, bei Weißwein waren es fast 90 % aller Proben! (2)
Belastungen komplett zu vermeiden ist unmöglich, aber wir können sie reduzieren.
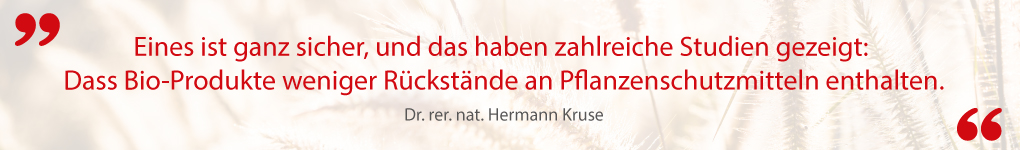
Glyphosat
Das hochumstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat nehmen wir vor allem über Getreide auf, es gelangt aber auch über Futtermittel (Getreidestroh) in unsere Nahrungskette. In einigen Ländern ist es nach wie vor üblich, vor der Ernte Glyphosat zu spritzen, um die Ernte zu erleichtern. In Deutschland und Österreich ist das verboten. Daher Kruses klarer Tipp: „Heimische Produkte bevorzugen.“
„Wir wissen aus Studien […], dass Glyphosat eindeutig teratogen ist, das heißt, dass es auf das ungeborene Leben wirkt, und es in hohen Dosen eine mutagene Wirkung hat.“ Das bedeutet, dass Glyphosat die Entwicklung des Fetus im Mutterleib stören und zu Fehlbildungen führen kann. Dagegen sind die epidemiologischen Studien zur Wirkung niedriger Glyphosat-Dosen nach Kruses Einschätzung nicht belastbar, weil sie nicht sauber gemacht sind. Trotzdem gäbe es ernstzunehmende Hinweise auf eine krebserregende und teratogene Wirkung, so dass man den Einsatz von Glyphosat unbedingt beschränken oder weitmöglichst verbieten sollte.
Grenzwerte – Trügerische Sicherheit
Anders als man denken könnte, sind die Grenzwerte für Pestizid-Rückstände nicht unbedingt toxikologisch begründet, das heißt, sie hängen nicht unbedingt von deren Giftigkeit ab. Vielmehr fließen bei der Festlegung von Grenzwerten neben der Toxikologie auch die Verzehrmenge und Erfahrungen aus der „guten landwirtschaftlichen Praxis“ mit ein. Dabei wird z.B. berücksichtigt, wie gut Landwirte auf den Einsatz eines Pestizides verzichten können. Hinzu kommt, dass für Stoffe ohne spezifischen Grenzwert die Höchstmenge einheitlich auf 0,01 mg/kg festgelegt wird – unabhängig davon, wie schädlich sie für Mensch und Umwelt sind.
Doch wie sieht es aus, wenn – wie in den meistens Fällen – in einem Nahrungsmittel mehrere Pestizide gemeinsam auftreten? Das Problem: Die Effekte der verschiedenen Stoffe, lassen sich nicht einfach aufsummieren, da sie sich auch gegenseitig verstärken können. Experten sprechen dann von einer synergistisch-exponentiellen bzw. überadditiven Wirkung. „Dieses Problem ist nach wie vor nicht gelöst“, so Kruse.
Fragwürdige Zulassung von Chlorpyrifos
Chlorpyrifos, das vielen als Mittel gegen Ameisen und andere Insekten bekannt sein dürfte, hatte bis 2020 eine EU-Zulassung. Derzeit wird eine Verlängerung geprüft, die Kruse für unverantwortlich hält. Warum?
Chlorpyrifos hemmt das Enzym Acetylcholinesterase, das bei der Reizweiterleitung in unseren Nerven eine wichtige Rolle spielt. Chlorpyrifos ist also ein Nervengift. Dennoch kommen streng vertrauliche Daten des Herstellers Dow-Chemical zu dem Schluss, dass es keine Hinweise auf neurotoxische Effekte gebe. Forscher, die auf Basis des schwedischen Informationsfreiheitsgesetzes Zugang zu den Daten erhalten konnten, kommen zu einem anderen Ergebnis. Demnach rufen bereits sehr niedrige Dosen in Tierexperimenten eindeutige Hirnschäden hervor. Zudem liefern epidemiologische Studien Hinweise auf eine nervenschädigende Wirkung von Chlorpyrifos beim Menschen. Ergebnisse, die Kruse auf Basis einer sehr großen Studie in Kindertagesstätten nur bestätigen kann. Auch die amerikanische Umweltbehörde (US-EPA) hat Zweifel an der angeblichen Sicherheit von Chlorpyrifos und sprach schon im Jahr 2000 von Datenmanipulation.
Wie brisant das Thema ist, zeigen Daten aus dem Jahr 2016: Von 16.000 in Deutschland untersuchten Obstproben waren 4 % erheblich mit Chlorpyrifos belastet und enthielten mehr als die gesetzliche Höchstmenge von 10 µg/kg!
Riskanter Weichmacher: Bisphenol A
Dass bei Industriestudien Skepsis angebracht ist, zeigen auch Übersichtsarbeiten (Metastudien) zu Bisphenol A (BPA) und dem Süßstoff Aspartam. Während gut 90 % der unabhängigen Studien Gesundheitsrisiken sahen, stuften alle Industriestudien die beiden Chemikalien als harmlos ein (3).
Bisphenol A hemmt bei Nagern schon in sehr niedrigen Konzentrationen das Immunsystem und die Entwicklung der Spermien (Spermotogenese) (ab 2 µg/kg Körpergewicht pro Tag). Zugleich beobachten Forscher seit den 1950iger-Jahren mit Sorge, dass die Spermiendichte bei Männern in Deutschland erheblich abnimmt. Dazu Kruse: „Eine Möglichkeit, die da eine Rolle spielen könnte, ist das BPA.“ Auch das Umweltbundesamt warnt vor der reproduktionstoxischen Wirkung von Bisphenol A (4).
Ergebnisse, die anscheinend auch die zuständigen Behörden wachgerüttelt haben: Nachdem der Wert für die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI) mit Blick auf die Leber- und Nierentoxizität viele Jahre bei 50 µg/kg KG pro Tag lag, wurde er 2015 auf 4 µg/kg KG pro Tag gesenkt. Nun postuliert die EFSA sogar eine Senkung auf 0,04 ng/kg Körpergewicht pro Tag (5). Der neue Wert ist etwa um den Faktor 100.000 niedriger als der bisherige! Für Kruse ein sensationeller Vorgang: „Das hängt damit zusammen, dass langsam durchgesickert ist, wie immunotoxisch Bisphenol A ist und wie stark es die Spermiendichte beeinflussen kann.“ Besonders brisant dabei: Der neue Wert liegt weit unter unserer tatsächlichen mittleren Aufnahme, die auf 30 bis 70 ng/kg Körpergewicht pro Tag geschätzt wird. „Wir liegen also weit über der Toleranzgrenze, was ich natürlich für ungemein bedenklich halte.“
Verboten ist BPA bei uns in Säuglingsfläschchen und weitgehend in Thermopapier (Kassenbons). Nach wie vor findet es sich im Haushalt, z.B. als Epoxidharz zur Innenbeschichtung von Konservendosen und in Wasserkochern. Kruse weiter: „Viele Hauptwasserleitrohre sind mit Epoxidharzen ausgekleidet und können BPA freisetzen.“ Ersatzprodukte wie Bisphenol S seien nicht hinreichend getestet und z.T. gäbe es auch hierzu kritische Hinweise.
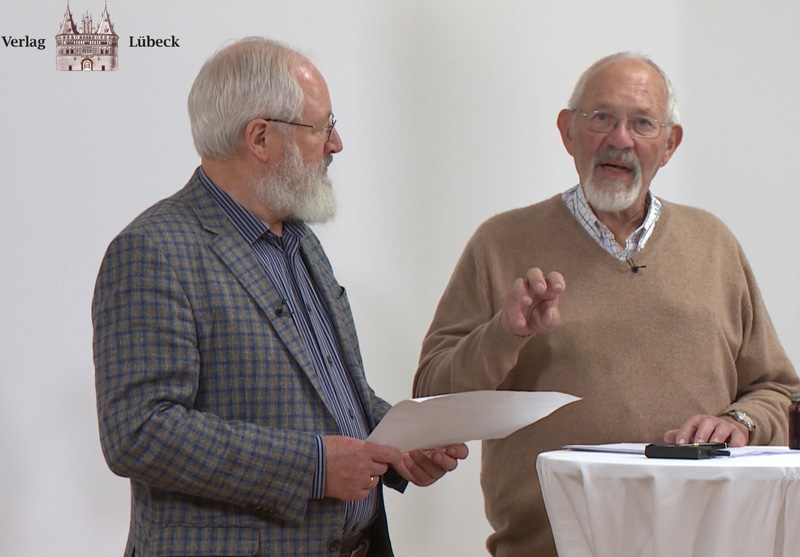
Schadstoff-Tipps von
Dr. Kruse
- Meiden Sie Kunststoffe mit dem Identifikationscode 03 PVC und 07 G – und zwar auch bei älteren Haushaltsgegenständen. Denn Bisphenol A kann aus dem Kunststoff lebenslang freigesetzt werden. Dagegen sind PET-Flaschen grundsätzlich frei von Bisphenol A.
- Dringend abzuraten ist von BPA-haltigen Wasserkochern, da es dort sehr heiß werden kann.
- Achten Sie auf den Hinweis „BPA-frei“, denn „Alle Produkte, die im Verdacht stehen Bisphenol A zu enthalten, aber keines enthalten, müssen gekennzeichnet sein mit ‚BPA-frei‘“, so Kruse.
Literatur und Hinweise
(1) Nach einem Vortrag von Dr. rer. nat. Hermann Kruse , Umwelttoxikologe der Christian-Albrechts-Universität Kiel, beim 22. Lübecker hoT-Workshop.
(2) Berichte zur Lebensmittelsicherheit 2019 – Monitoring
(3) Vom Saal FS, Hughes C: An extensive new literature concerning low-dose effects of bisphenol A shows the need for a new risk assessment. Environ Health Perspect 2002, 113 (8), 926–933
(4) Umweltbundesamt zu Bisphenol A, 22.10.2021
(5) EFSA: Bisphenol A: In dem Gutachtenentwurf der EFSA wird vorgeschlagen, die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge herunter zu setzen. 15.12.2021































